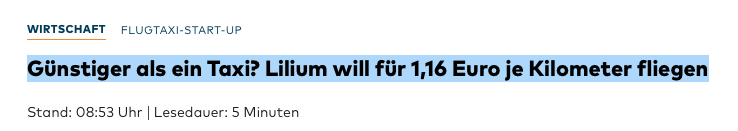Wenn man denkt, der Gipfel der Absurdität müsste langsam überschritten sein, geht der Steigflug plötzlich weiter. So ist es beim Nicht-Flugtaxi „Lilium Jet“ – und der Berichterstattung über einen Unternehmer, bei dem das Jahr 403 Tage hat.
Kürzlich hatte ich hier schon am Beispiel eines Beitrags aus der „Welt“ die vollkommen weltfremden Behauptungen des Weßlinger Flugzeug-Nichtherstellers Lilium auseinandergenommen, die es trotz ihres eklatanten Mangels an Plausibilität in die Presse geschafft hatten. Heute legte die Zeitung aus dem Springer-Verlag noch einmal nach und bewies damit, dass PR- und IR-Manager mit der nötigen Chuzpe manchen Kollegen – und Investoren – wirklich die abstrusesten Zahlen vorlegen können, ohne dass diese endlich mal sagen: „Ja, spinnt Ihr denn jetzt endgültig?“
Schon die Überschrift des Beitrags anlässlich des jetzt vorgestellten Börsenprospekts ist eine reinrassige Ente. Lilium wolle für 1,16 Euro je Kilometer fliegen, heißt es unter der – ebenso entenhaften – Dachzeile „Flugtaxi-Start-Up“. Es wird sich allein schon deshalb niemand für 1,16 Euro pro Kilometer ein Flugtaxi kommen lassen können, weil niemand Flugtaxis bauen will, sondern den „ICE der Lüfte“.
 „Nicht-Flugtaxi: Lilium-Märchen wird immer abstruser“ weiterlesen
„Nicht-Flugtaxi: Lilium-Märchen wird immer abstruser“ weiterlesen