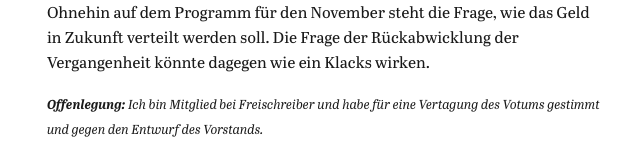„Weltgrößter BGE-Versuch in Kenia“, titelt das Social-Business-Magazin Enorm, „26.000 Menschen, 300 Dörfer, 12 Jahre, 0,75 Dollar am Tag – das sind die Eckpunkte des größten Experiments, das bislang zum bedingungslosen Grundeinkommen stattfinden soll.“ Tja, das stimmt schon mal nicht, denn das Budget des Experiments beträgt nur 30 Millionen Dollar. Wenn 26.000 Menschen je 75 Cent pro Tag erhielten, wären das 19.500 Dollar am Tag, binnen 12 Jahren oder 4383 Tagen also 85.468.500 Dollar.
Liest man weiter, erfährt man, dass weder 300 Dörfer Geld bekommen noch 26.000 Menschen 12 Jahre lang. Das fängt damit an, dass 100 Dörfer als Kontrollgruppe definiert sind; dort bekommt niemand auch nur einen Cent dafür, dass er sich der Neugier amerikanischer Möchtegern-Sozialwissenschaftler stellt, die sich damit brüsten, das größte Experiment der Weltgeschichte zu veranstalten
„We’re running the largest experiment in history.“
Bleiben 200 Dörfer. In 160 von ihnen, also 80 Prozent, ist nicht nach zwölf, sondern schon nach zwei Jahren Schluss. Diese Gruppe mit 20.000 Teilnehmern wird noch einmal geteilt. Eine Hälfte bekommt monatlich ein Pro-Kopf-Grundeinkommen von 22,81 Dollar ausbezahlt, die andere Hälfte einen Einmalbetrag von 547,50 Euro. Nur die restlichen 40 Dörfer mit zusammen 6000 Bürgern nehmen an der Langzeitstudie teil. Bedingungslos, wie die enorm-Redaktion ausweislich ihrer Headline glaubt, ist das Grundeinkommen übrigens selbst dann nicht, wenn man die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Dorfgemeinschaft alternative-facts-technisch zur Nichtbedingung schönredet: Man muss erwachsen sein. Kinder gehen leer aus, und die Eltern bekommen das Grundeinkommen auch nicht als Kindergeld anvertraut.
Noch mal nachgerechnet:
20.000 mal 547,50 sind knapp elf Millionen Dollar. Die 6.000 Langzeitprobanden erhalten zusammen knapp 20 Millionen Dollar. Wenn die nötigen 31 Millionen zusammenkommen, wird man etwa anno 2030 einen Abschlussbericht erwarten können. Solange hat das Experiment also schon einmal keinen wissenschaftlichen Nutzen.
Ob es ihn je haben wird? Die Dörfer haben – zuzüglich Kinder und Jugendliche – eine durchschnittliche Einwohnerzahl von 125 (Zwei-Jahres-Probanden) beziehungsweise 150 (Zwölf-Jahres-Gruppe), also geschätzt 300 Einwohner. Ich kenne die Siedlungsstruktur nicht, aber die Spreizung dürfte so ausfallen, dass 1000 Einwohner schon den oberen Rand bilden. Das heißt: Das gesamte Experiment beschränkt sich auf Gemeinden, in denen jeder jeden kennt. Das dörfliche Sozialverhalten auf dem Land dürfte sich von dem in einer Großstadt wie Nairobi signifikant unterscheiden.
Welche Rückschlüsse man aus den Daten dann erst auf die Auswirkungen eines Grundeinkommens in, sagen wir, New York City oder dem Freistaat Bayern ziehen können soll, bleibt das Geheimnis der Empirie-Genies aus Amerika – und der deutschen Redaktionen, die unkritisch über solche „Studien“ berichten, bei denen Menschen in fernen Ländern in neokolonialer Manier zu Studienobjekten degradiert und für ihre Teilnahme mit einem Almosen abgespeist werden, das nicht einmal alle erhalten.


 Mehr als 15 Jahre ist es her, dass ich das erste Mal über den LEOH geschrieben habe, den Lebensmittel-Onlinehandel. Schon damals konnte man haltbare Spezialitäten – etwa Kaffee, Tee, Gewürze – im Internet bestellen. Was nie richtig ans Laufen kam, waren Vollsortiments-Angebote. Wer sich im LEH (Lebensmittel-Einzelhandel) auch nur ein bisschen auskennt, weiß: Im Netz lässt sich ein normaler Supermarkt nicht mit vertretbarem Aufwand 1:1 abbilden. Das Sortiment an industriell konfektionierten Markenartikeln mag zwar leicht zu handhaben sein, der USP jedes guten Ladens ist jedoch seine abwechslungsreiche Auswahl an frischen Produkten, die entweder nach Marktlage zu Tagespreisen eingekauft werden wie Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch, oder den regionalen Vorlieben angepasst sein müssen wie das Käsesortiment oder Brot und Kuchen von regionalen Bäckereien. Selbst wenn diese nur 20 Prozent des Umsatzes beisteuern, verursachen sie gewiss mehr als 80 Prozent des Aufwands für die Pflege der Produktdatenbank.
Mehr als 15 Jahre ist es her, dass ich das erste Mal über den LEOH geschrieben habe, den Lebensmittel-Onlinehandel. Schon damals konnte man haltbare Spezialitäten – etwa Kaffee, Tee, Gewürze – im Internet bestellen. Was nie richtig ans Laufen kam, waren Vollsortiments-Angebote. Wer sich im LEH (Lebensmittel-Einzelhandel) auch nur ein bisschen auskennt, weiß: Im Netz lässt sich ein normaler Supermarkt nicht mit vertretbarem Aufwand 1:1 abbilden. Das Sortiment an industriell konfektionierten Markenartikeln mag zwar leicht zu handhaben sein, der USP jedes guten Ladens ist jedoch seine abwechslungsreiche Auswahl an frischen Produkten, die entweder nach Marktlage zu Tagespreisen eingekauft werden wie Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch, oder den regionalen Vorlieben angepasst sein müssen wie das Käsesortiment oder Brot und Kuchen von regionalen Bäckereien. Selbst wenn diese nur 20 Prozent des Umsatzes beisteuern, verursachen sie gewiss mehr als 80 Prozent des Aufwands für die Pflege der Produktdatenbank.