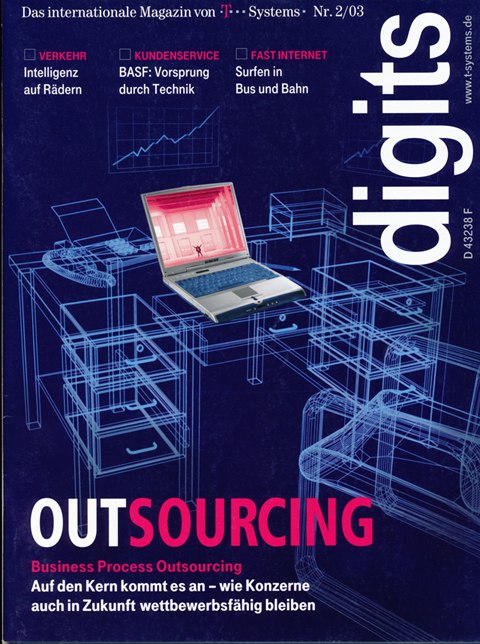Interview mit Michael Hammer über Business Process Management
Dr. Hammer, vor fast zehn Jahren haben Sie und James A. Champy ein „Manifest für eine Revolution“ aufgestellt – so der Untertitel Ihres Bestsellers „Business Reengineering“. Die Revolution, die kurz darauf ausbrach, wirkte jedoch wie ein surrealistisches Experiment und nannte sich New Economy.
Was wir in den späten Neunzigern sahen, war ein Irrweg in der Wirtschaftsgeschichte: eine Periode, in der sich Verbraucher, Unternehmen und Investoren gleichermagen in eine Fantasiewelt davontragen ließen. Es war ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Verbraucher lebten weit über ihre Verhältnisse, beflügelt von den nimmer endenden Wertsteigerungen ihrer Aktien und Immobilien; daraufhin blähten Unternehmen ihre Kapazitäten auf und liefen hirnlosen Konzepten hinterher, die sich vor allem ums Internet drehten. Investoren verloren den Blick für den wahren Wert von Unternehmen und zahlten extravagante Preise für Aktien von Firmen, die auf der Wachstumswelle ritten.
Was haben Sie gedacht, als Sie merkten, dass so viele Entscheidungsträger das Einmaleins der Betriebswirtschaft zusehends bedeutungslos fanden?
So ein Kreislauf ist grundsätzlich instabil und auf lange Sicht nicht durchzuhalten. Irgendwann kommt die Realität ans Licht, und dann kracht das ganze System zusammen. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis unsere Wirtschaft wieder auf Normalmaß geschrumpft ist. Je wilder die Party, desto schlimmer der Kater. In der wirtschaft- lichen Blase der späten Neunziger hielten viele Firmenlenker es für unnötig, die Grundlagen der Wirtschaft zu beachten. Sie verdienten ja auch so ganz leicht Geld. Jetzt bezahlen sie den Preis dafür…
… und die Vernunft kehrt zurück.
Die zentrale Idee des Business Reengineering – Geschäftsprozesse von vorne bis hinten neu zu durchdenken, um Ballast an Zeit und Kosten aus Betriebsabläufen zu eliminieren – ist jedenfalls wieder en vogue. Process Redesign steht überall auf der Tagesordnung; die Unternehmen machen dort weiter, wo viele von ihnen 1997 aufgehört hahen. Und die treihende Kraft hinter der Renaissance des Reengineering ist die Macht des Kunden. Fast jede Branche hat sich Überkapazitäten geschaffen. Die Untemehmen stecken in einer Falle aus Inflation und Deflation: Die Rohmaterialien werden immer teurer, die Preise der Fertigprodukte sinken. Die Kunden nehmen Preiserhöhungen und Serviceverschlechterungen einfach nicht mehr hin. Der einzige Ausweg besteht darin, mit neuem Eifer nach Innovationen im Betriebsablauf zu suchen.
In Ihrem neuen Buch „Business Back to Basics“ vertreten Sie den Standpunkt, dass Kahlschläge zur Kostensenkung nicht zur heutigen „Customer Economy“ passen. Innovationen müssten demnach die Bereitschaft der Kunden steigern, bessere Produkte und Dienstleistungen zu kaufen und womöglich sogar mehr Geld dafür zu bezahlen. Wie kann Process Redesign denn einer Firma helfen, nicht einfach unproduktive Arbeiten abzuschaffen, sondern vor allem dem Kunden Gutes zu tun?
Innovation heißt, Arbeitsmethoden zu finden, die bei geringeren Kosten den Nutzen für den Kunden erhöhen. Das können neue Ansätze für die Auftragsabwicklung sein wie bei Dell, solche für Einkauf und Bestandsmanagement wie bei Walmart, für die Produktentwicklung wie bei lBM oder für den Kundendienst wie bei Pratt & Whitney. In jedem dieser Fälle war es eine völlig neue Herangehensweise, mittels derer Abläufe, die zur Wertschöpfung nichts beitrugen, eliminiert wurden – was zu herausragender Performance führte. Diese Beispiele zeigen, dass niedrige Kosten nicht zwingend mit Abstrichen bei der Kundenzufriedenheit erkauft werden müssen. So hat der große Lebensmittelhersteller General Mills mit einem Redesign seiner Logistik erreicht, dass der Anteil der unverzüglich ausgeführten Bestellungen gestiegen ist, bei gleichzeitig sinkenden Lagerbeständen. Bisher hatte man angenommen, eine Verbesserung auf der einen Seite bedinge eine Verschlechterung auf der anderen. Indem man dies aber mit einem innovativen Prozess angeht – in diesem Fall einem, der die Produktionsplanung nicht mehr auf Absatzprognosen stützte, sondern auf die tatsächliche Nachfrage – konnte sich General Mills sozusagen den Pelz waschen, ohne nass zu werden. IBM konnte den Produktentwicklungszyklus um 75 Prozent reduzieren. Bei rund 45 Prozent niedrigeren Kosten und einer um ein Viertel höheren Zufriedenheit der Kunden mit neuen Produkten. Gegen Kosten hilft also kein Kahlschlag, sondern eine Planung, die sie gar nicht erst anfallen lässt. Wenn das gelingt, verbessern sich Geschwindigkeit und Qualität gleichermaßen. Und der Kunde ist glücklicher.
Gelingt das denn wirklich? Von der Erkenntnis, dass Zeit tatsächlich Geld ist, bis zum Umkrempeln des eigenen Managementstils ist es ein langer Weg. Eine Studie über die Einführung von Wissensmanagement in deutschen Firmen ergab, dass große Konzerne neue Prozesse, welche die persönliche Macht bestimmter Manager gefährden könnten, ziemlich behutsam angehen. Weichen Anreiz hat ein Manager, durch Optimierung seiner Geschäftsprozesse zu offenbaren, wie unproduktiv seine Abteilung bisher war?
Nennenswerte Verhesserungen bei der Performance eines Unternehmens sind zwangsläufig mit organisatorischen Umwälzungen verbunden. „No pain, no gain“, heißt es in den USA – ohne Schweiß und Schmerzen kein Preis. Prozessorientierte Neuerungen verändern stets die Rolle von Managern. Schließlich halten sich Prozesse nicht an Funktionsgrenzen. Oder, wie ein Top-Manager mal gesagt hat: „Wenn einer meiner Manager sagt, er mag keine Prozesse, heißt das nur, dass er seine Macht nicht mit jemand anderem teilen will.“ Prozesse zu verbessern, verlangt den Managern ab, dass sie lernen, miteinander zusammenzuarbeiten, und dass sie sich auf Kunden und aufs gesamte Unternehmen konzentrieren – nicht auf ihre eigene Abteilung. Deshalb ist es entscheidend, dass sich die obersten Führungskräfte selbst an die Spitze des Wandels stellen. Die ranghöchsten Manager müssen ihren Untergebenen klarmachen, dass Process Redesign von essenzieller Bedeutung fürs Unternehmen ist und dass es auf jeden Fall fortgesetzt wird. Diejenigen, die das zu blockieren versuchen, gefährden sich selbst. Allerdings sollten die Vergütungssysteme für Manager dahingehend überarbeitet werden, dass diejenigen helohnt werden, die die Performance des gesamten Prozesses und damit des ganzen Unternehmens voranbringen – nicht diejenigen, die nur an den Erfolg der eigenen Abteilung denken. Durch aktive Beteiligung, stetige Kommunikation und absolute Identifikation mit dem gemeinsamen Ziel können Vorstände ihre Manager motivieren, ihren Teil zur Veränderung der Prozesse beizutragen, selbst wenn es deren kurzfristigem Eigeninteresse scheinbar widerspricht.
Und wer soll den Anfang machen? Nicht jeder Chef erkennt sofort, was ihm die Prozessoptimierung bringt.
Generell gibt es keinen Ersatz für Führungsstärke. Einige Chefs schaffen es selbst, nicht nur ein Verständnis für den Prozess-Einsatz zu entwickeln, sondern sich auch voll dahinter zu stellen. Für gewöhnlich ist es jemand etwas weiter unten in der Hierarchie, der als Katalysator wirkt und die Unternehmensführung überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Der Katalysator muss erkläen, was Prozesse überhaupt sind. Dann muss er seine Bosse mit den Führungskräften anderer Unternehmen zusammenbringen, die mit Prozessen gute Erfahrungen gemacht haben, und manchmal muss er ein kleines Vorzeigeprojekt aufsetzen, das zeigt, class auch in seiner Firma Prozessverbesserungen funktionieren. Solch einen Katalysator findet man auf jeder Ebene der Firma, aber es muss jemand sein, dessen oberstes Anliegen das Wohl der ganzen Firma ist und der Glaubwürdigkeit genießt.
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Rolle externer Berater?
Sie können hilfreich sein, aber normalerweise nicht in die Rolle des Katalysators schlüpfen.
In der vernetzten Wirtschaft von heute müssen prozessorientierte und traditionelle Betriebe im Echtzeit-Modus miteinander arbeiten. Heißt das, dass der Vorreiter den Langsamen mitzieht? Oder diktiert der stärkere Geschäftspartner dem schwächeren, was er zu tun hat, um im Geschäft zu bleiben?
Nach meiner Erfahrung erwarten starke prozessorientierte Unternehmen früher oder später, dass ihre Zulieferer ebenfalls ihre Prozesse optimieren, und zwar nicht nur, um ihre eigene Performance zu steigern, sondern auch um die Prozesse beider Firmen miteinander zu verknüpfen. Bis dahin kann die Kundenfirma von ihren eigenen Arbeiten am Prozess profitieren, aber diese Vorteile wachsen substanziell, wenn die Prozesse über Firmen- und Funktionsgrenzen hinweg integriert werden.
Das klingt überzeugend, hat aber einen großen Nachteil – jedenfalls aus Sicht von Vorständen, die nur aufs Quartalsergebnis schielen: Die Veränderungen haben keinen unmittelbaren Effekt auf den Aktienkurs. Sie brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Was raten Sie den Katalysatoren, die ihre Chefs überzeugen wollen, aktiv zu werden?
Auf diese Frage habe ich zwei Antworten.
Erstens: Prozessbasierte Veränderung ist zwar eine langfristige Anstrengung, die in der Tat Jahre braucht, doch sie kann – und muss – so gemanagt werden, dass sie schnell erste Ergebnisse zeitigt. Wenn nicht in einem Quartal, so doch in zwei oder drei. Programme, die Jahre brauchen, bis sie sich überhaupt irgendwie auszah len, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Angesichts der bevorstehenden Veränderungen werden Organisationen ängstlich, und es macht sich Zweifel breit, ob sich die versprochenen Resultate jemals einstellen werden. Unterdessen lassen sich die Führungskräfte durch andere Aufgaben ablenken. Darum ist es unabdingbar, neue Prozesse schrittweise einzuführen. Jeder einzelne dieser Schritte muss in sechs bis neun Monaten zu bewältigen sein und signifikante, vor allem auch messbare Verbesserungen des Betriebsablaufs bewirken. Mit dieser Einführungsstrategie sollten sich sogar relativ kurzfristig orientierte Führungskräfte abfinden können. So ein Programm wird, wenn man denn alles richtig macht, fast zum Selbstläufer. Die Ergebnisse der ersten Schritte bilden die Grundlage für die weiteren.
Teil zwei meiner Antwort: Wenn wir in den letzten zwei Jahren irgendetwas gelernt haben, dann ist es doch, dass die Zeit des Quartalsdenkens im Management vorüber ist. Die Fixierung auf kurzfristige Ergebnisse war schließlich, was die Skandale bei Enron, WorldCom und dem Rest möglich gemacht hat. Die Führer wirklich erfolgreicher Firmen tun das, was langfristig richtig ist, ohne den Quartalsergebnissen ungebührliche Beachtung zu schenken. Wer anderes tut, belastet den realen Wert seines Unternehmens zu Gunsten kurzfristiger und vorübergehender Vorteile mit einer schweren Hypothek.
In der Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Partnern müssen heute die Schnittstellen oft sehr aufwändig gemanagt werden. Wenn die Beteiligten ihre Daten austauschen und besser kooperieren würden, könnte viel Zeit gespart werden. Stichwort: Real-Time Management. Worauf kommt es bei der Gestaltung von unternehmensübergreifenden Prozessketten an? Wie werden Collaboration und RTE zum Erfolg?
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, ohne volle technische Unterstützung gebe es keine Verbesserungen von Geschäftsprozessen innerhalb eines Unternehmens oder über Firmengrenzen hinweg. Ganz im Gegenteil: Technik kann die Performance neuer Process Designs steigern. Diese zu implementieren, bedeutet aber keineswegs, sich der Technik untertan zu machen. Der Schlüssel zum Etablieren firmenübergreifender Prozessketten liegt darin, sich mit Geschäftspartnern – Kunden wie Lieferanten – zusammenzutun und den gesamten Prozess von vorne bis hinten zu überdenken. Wenn Informationen auf beiden Sei ten der Firmengrenze benötigt werden und es noch keine Schnittstellen zwischen den Systemen gibt, tun es zur Not auch EDI oder gelegentliche Dateiübertragungen. In Unternehmen, die ihre Abläufe verbessern müssen, soll es immer schnell gehen, und der Mangel an Schnittstellen und andere lnfrastrukturprobleme sollten nicht als Entschuldigung herhalten oder als Hindernis angesehen werden.
Keine Zukunft für Alphatiere
Michael Hammer plagt das schlechte Gewissen. Eine Lawine habe er losgetreten, meint der Autor des 1993 erschienenen Weltbestsellers „Business Reengineering“ (Auflage: über zwei Millionen Exemplare), eine Lawine von Management-Ratgebern, von denen viele der Welt besser erspart geblieben wären. Als Sühne für dieses unabsichtliche Vergehen hat Hammer wiederum ein Buch geschrieben, dessen deutsche Fassung unter dem englischen Titel“ Business back to Basics“ im Econ-Verlag erschienen ist. Darin seziert der frühere Informatik-Dozent am Massachusetts Institute of Technology die Betriebsabläufe in Unternehmen verschiedener Branchen. Hammers Kernthese: In der „Customer Economy“ ist nur erfolgreich, wer seine Geschäftsprozesse konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichtet. Anhand konkreter Beispiele zeigt der Autor, wie sich Manager manchmal selbst oder einander im Weg stehen und wie sie mit etwas Nachdenken Qualität und Service verbessern und gleichzeitig Kosten senken können.
Michael Hammer
Business back to Basics
Die 9-Punkte-Strategie für den Unternehmenserfolg
Econ-Verlag, München 2002, 320 Seiten, 29 Euro, ISBN 3-430-13908-2
aus: Scheer Magazin 2-2003
 Ein einziges Kommunikationsnetz reicht künftig aus für den gesamten Informationsaustausch in Konzernen. Die Integration von Telefon, Intranet und Videokonferenz in ein System senkt die Übertragungskosten, erhöht die Flexibilität und reduziert den Managementaufwand.
Ein einziges Kommunikationsnetz reicht künftig aus für den gesamten Informationsaustausch in Konzernen. Die Integration von Telefon, Intranet und Videokonferenz in ein System senkt die Übertragungskosten, erhöht die Flexibilität und reduziert den Managementaufwand.