Manche Kulturredakteure verirren sich gerne mal auf wirtschaftliches Terrain. Geld regiert die Welt, also müssen auch sie mitreden. Sollen sie. Nun erwarte ich nicht einmal, dass sie deutsche Billionen und amerikanische Billions auseinanderhalten können oder gar wissen, wieviele Ziffern dabei links vom Komma stehen. Leute, die damit nicht zurecht kommen, finden bei Tageszeitungen ja sogar im Wirtschaftsressort Jobs. Allerdings sollten sich die Kollegen wenigstens mit den Begrifflichkeiten vertraut machen, die sie verwenden.
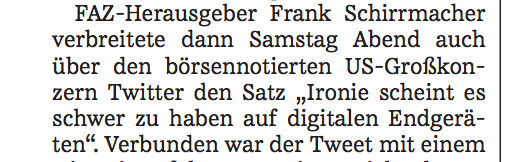
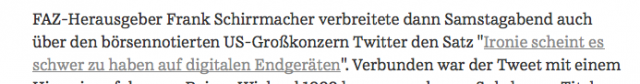
So hält der forsche Dirk von Gehlen, Internetversteher vom Dienst bei der Süddeutschen Zeitung, Twitter für einen börsennotierten US-Großkonzern. Korrekt daran ist, dass Twitter in den USA ansässig ist und an der Börse notiert ist. Allerdings ist das Unternehmen weder groß noch ein Konzern. Als US-Großkonzerne gelten gemeinhin die Betriebe, die in den Fortune 500 zu finden sind. Firmen dieser Liga verbuchen jährliche Umsätze ab etwa fünf Milliarden Dollar. Twitters 2700 Beschäftigte bringen es nur auf 664 Millionen Dollar, vergleichbar etwa mit der mittelständischen Allgäuer Käserei Champignon („Cambozola“). Pro Dollar Umsatz erwirtschaftet Twitter allerdings fast einen Dollar Verlust – das können und wollen die bayerischen Senner nicht bieten.
Twitter könnte den Umsatz versiebenfachen und würde noch immer nicht im Fortune-Ranking erscheinen. Zwischen dem Zwitscherdienst und der derzeitigen Nr. 500, dem Lebensmittelgrossisten Nash Finch, liegen nämlich noch ein paar Tausend andere Aspiranten. So viel zur Größe.
Ein Konzern wiederum zeichnet sich dadurch aus, dass er Tochterfirmen hat, die eigene Geschäfte tätigen, meist unter eigenen Marken und oft in anderen Geschäftsfeldern als die Mutter. Amazon ist zum Beispiel ein Konzern. Twitter hat zwar ein paar Startups geschluckt, aber um sie in die eigene Firma zu integrieren.
Sie sind der oder die 3977. Leser/in dieses Beitrags.


Hatte ich übersehen -was aber vielleicht auch zeigt, dass es nicht ganz so wichtig ist wie Du es hier machst, Ulf. Was haste denn gegen die SZ und den Schreiberling?
Ich habe nichts gegen die SZ. Es ist immer noch die Zeitung, die ich am liebsten lese. Leider spart sie am falschen Ende, unter anderem am Gegenlesen. Dieses Phänomen tritt besonders häufig bei netz- oder IT-nahen Themen auf, aber auch bei Architektur und Design. Für diese Themen hat die Zeitung in den vergangenen Jahren ein paar junge Talente engagiert, bei denen es leider nötig wäre, dass erfahrenere Kolleginnen oder Kollegen die Elaborate kritisch prüfen. Diese jungen Leute sind sehr produktiv und kreativ, aber setzen eben auch sehr vieles in die Welt, das plausibel klingt und sich meist flott liest, aber halt doch nur hingeschnoddert ist. Eloquentes Zeilenschinden halt. Und darunter leidet der Gesamteindruck des Blattes. Wenn ich im Feuilleton Artikel lese, deren Autorin weder den Unterschied zwischen Elektrik und Elektronik kennt noch den zwischen einem Ur-Mac und dem ersten iMac, aber schlaumeierisch über Technikgeschichte schreibt (namentlich Braun und Apple), wenn dieselbe Kollegin dann das erst 1956 von Pierre Angénieux entwickelte Zoom-Objektiv an die Leicas von Wehrmachtsfotografen im zweiten Weltkrieg montiert, schäme ich mich fremd vor so viel ostentativer Ignoranz. Ähnlich geht es mir, wenn Kollegen ihre Bildungslücken in Sachen Internetwirtschaft offenlegen. Diese Typen liefern denen, die webauf, webab über den so genannten Qualitätsjournalismus lästern, das Futter. Und wir alle haben davon den schlechten Ruf. (Disclaimer: Ich rege mich nur bei den Themen auf, bei denen ich mitreden kann. Leider fürchte ich, dass das bei anderen Themen auch so sein könnte – nur dass mir das nicht auffällt.)
Doch. (Screenshot hierzu nachträglich eingefügt.)
Find die SZ in Sachen digital auch merkwürdig, muss hier aber sagen: In dem verlinkten Text ist der Bezug Twitter = Großkonzern doch gar nicht hergestellt!