Sommer 2014, eine Reha-Klinik im Sauerland, Teil eines bedeutenden Konzerns der Krankheitsbewirtschaftungsindustrie mit altgriechisch und lateinisch anmutenden Firmennamen. Eine alte Dame wird eingewiesen, postoperatives Durchgangssyndrom nach einem Sturz im Altenheim mit Kopfverletzung. Mit anderen Worten: Die Patientin hat wahrscheinlich noch die meisten Tassen im Schrank, ist aber zumindest für einige Wochen nicht in der Lage, sie der Reihe nach zu gebrauchen.
Aufgabe der Klinik ist die neurologische Frührehabilitation. Eine Frau Mitte 80, die dank fähiger Intensivmediziner noch am Leben ist, aber vorerst nicht begreift, wo sie ist oder wie spät es ist, muss man sich vorstellen wie ein ängstliches, mit der Wahrnehmung seiner Umwelt überfordertes kleines Kind, dem Erinnerungen aus acht Jahrzehnten im Kopf herumspuken – Erinnerungen, die diese kindliche Greisin nicht sortieren kann. Sie weiß noch, dass Tassen und Becher zum Trinken da sind und wie man sie in etwa handhaben muss, um nichts zu verschütten. Sie weiß aber nicht, dass sie sechs oder sieben Becher am Tag leertrinken muss. Sie weiß schon gar nicht, dass vor allem das Gehirn viel Flüssigkeit braucht, um sich einigermaßen zu regenerieren. Sie hat die alten Filme vergessen, deren in glühender Saharasonne dehydrierende Helden halluzinierten und delirierten. Es ist im Sauerland doch nicht heiß, warum soll sie trinken? Ihr ist nicht wohl, aber ihr Gehirn erkennt nicht, dass das Gefühl ihr Durst ist. Sie ahnt nicht, dass es ihr nach ein, zwei Tassen besser ginge. Sagt man es ihr, glaubt sie es nicht – sie, die noch vor Wochen so ausdauernd und kenntnisreich über allerlei medizinische Themen fachsimpeln konnte.
Wer als Patient mitdenkt, ist fast schon geheilt
Jedem verständigen Menschen müsste einleuchten, dass Patienten in dieser Phase nach Unfall, Operation oder Schlaganfall keinen Sinn und schon gar kein Verständnis haben für den krankenhausüblichen Tagesrhythmus aus hochstandardisierten und zugleich höchst lebensfernen Abläufen: zu festen Zeiten zu essen, Pillen zu schlucken und möglichst mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks zu trinken. Sie sollen sich Reglements zu unterwerfen, die allein der Logik von Rationalisierungsexperten entspringen, aus deren Sicht der Patient kein Kunde oder sonstwie relevanter Stakeholder ist. Für die Controller ist der Kranke ein unvermeidlicher Stör- und Kostenfaktor in dem Geschäftsprozess, auf den seine Genesung reduziert wird. Kann er nicht für sich selbst sorgen oder entscheiden, wird er nicht als Subjekt behandelt, sondern als Objekt. Dummerweise erfordert die Unterwerfung unter das Primat vermeintlicher Effizienz die Fähigkeit zu diszipliniertem Verhalten – also zum Mitdenken, zu bewussten Entscheidungen und somit zu einem bereits wiederhergestellten Bewusstsein. Wenn der Patient begreift, dass die Personalkosten der Klinik und vielleicht auch die Kassenbeiträge sinken, wenn er brav mitmacht, kann man ihn fast schon als geheilt entlassen.
Die Schwester – typischerweise eine nette, bemühte, mütterlich-besorgte Russin oder Kasachstan-Deutsche mit einem süßen Akzent – hat keine Wahl. Sie muss sich dem Regime der Kostenoptimierer beugen. Deshalb überfällt sie die alte Dame mit dem Frühstückstablett zu einer Zeit, zu der diese zu Hause immer noch schlief. Mittagessen gibt es um 11:30 Uhr MESZ, mit der biologischen Uhr gefühlt also morgens um halb elf. Kurz nach 16 Uhr, gefühlt nachmittags um drei, schwärmen die Damen mit dem Abendbrot aus. Spätestens um 17 Uhr ist es einzunehmen, denn um 18 Uhr ist Schicht im Schacht. Für die Schnittchen heißt das: Bauch oder Tonne.
Als wären die Zeiten nicht eh absurd früh, verschärft die Sommerzeit die Absurdität nur: Ausgerechnet in einer Station, in der mangels Reaktivierung des Verstandes bestenfalls die innere Uhr das Leben der Patienten zu rhythmisieren vermag, gilt ein willkürliches und dabei sehr striktes Taktsystem, das gegenüber dem subjektiven Zeitgefühl um mehrere Stunden verschoben ist. Menschen, die jahrzehntelang „Tagesthemen“ und späte Polittalks geschaut haben, ein Getränk und eine Schale Knabberzeugs vor sich, müssen die Umstrukturierung ihres Tages wie einen permanenten Jetlag empfinden. Menschen, die wieder fit gemacht werden müssten für ihr normales Leben, werden in ein Standardschema gezwängt, das für ihre Bedürfnisse und Vorlieben keinen Platz lässt.
Empathie geht durch den Magen
Die Realität ist einfach nur traurig. Essen landet im Müll, während Schwestern und Ärzte Angehörigen vorjammern: „Die Patientin isst nichts.“ Dabei stimmt das, wie wir noch sehen werden, so pauschal gar nicht. Leider gehören Ernährungsgewohnheiten und Aversionen gegen bestimmte Speisen aus unerfindlichen Gründen bis heute nicht zur Standard-Anamnese bei stationärer Versorgung. Schlimmer noch: Es gibt Mediziner, die Patienten offenbar ungeachtet ihrer jeweiligen Hirnleistung für konditionierbar halten (man muss essen, wenn das Tablett kommt) und aus Momentaufnahmen unzulässige Schlüsse ziehen. Sieht so ein Arzt wiederholt ein unberührtes Tablett, löst dies bei ihm den Reflex aus, er müsse die Patientin nun „fixieren“, also ans Bett fesseln lassen, um ihr gewaltsam über einen Schlauch eine Nährlösung in den Magen zu pumpen, als sei sie eine hungerstreikende RAF-Terroristin, die um jeden Preis ihren Prozess erleben soll.
In Wahrheit können die Gründe, aus denen Patienten ihr Essen erst einmal links liegen lassen, sehr banal sein. Es ist Alltag, dass das Pflegepersonal nur registriert, ob jemand zu wenig isst, aber nicht, ob es bestimmte Dinge gibt, die er immer liegen lässt oder die besonders oft im Müll landen. Jeder bekommt ungefragt ein Brot mit Streichwurst, eines mit Frischkäse und eines mit anderem Käse. Fruchtjogurt wird sortiert angeliefert, aber wer welche Sorte bekommt, bestimmt das Pflegepersonal nach dem Zufallsprinzip. Mit der Frage „schmeckt Ihnen das nicht?“ kommt man leider nur bedingt weiter: Wer unter dem Durchgangssyndrom leidet, meint oft nicht das, was er sagt. Man müsste schon wissen, was das notleidende Gehirn von dem Input, den die fünf Sinne anliefern, in diesem Moment gerade verarbeitet und was es mit den noch gespeicherten Informationen abgleichen kann. Mit dem Prinzip von Versuch und Irrtum lässt sich aber eingrenzen, wo die Vorlieben der einzelnen Kranken liegen. „Liebe geht durch den Magen“, sagt der Volksmund. Es muss nicht Liebe sein, Empathie genügt: Auch Kranke spüren die Wertschätzung, die darin liegt, dass man ihnen zur rechten Zeit schmackhafte Kost anbietet. Die Friss-oder-stirb-Methode (hier: Iss-oder-ich-zwangsernähre-Dich-Methode) demotiviert die Patienten und schürt Ängste – gerade auch, wenn Schwestern schon mal auf die hinterhältig-wohlmeinende Idee gekommen sind, die freiwillig nicht geschluckten bitteren Pillen im Apfelmus zu verstecken. Solche Unterjubeleien zerstören das Vertrauen und sind somit völlig kontraproduktiv. Der Widerstand gegen die Einnahme vermeintlich schädlicher Tabletten ist ja eigentlich ein Indiz für die Rückkehr des eigenen Willens, nur dass sich der Wille leider vor der Vernunft erholt. In so einer Situation hat der Versuch, Kranke zum ihrem Glück zu zwingen, wenig Sinn.
Dieselbe Patientin, die das Frühstück stehen lässt, bis das noch volle Tablett um 9 Uhr früh abgeräumt wird und die Kost unberührt im Container landet, lässt sich jedenfalls vormittags von ihrem Sohn mit frischen Erdbeeren und Aprikosen zum Naschen verführen, ja scheint mit dem Obst einen regelrechten Heißhunger zu befriedigen. Sie verschlingt zur normalen Kaffeekränzchenzeit einen knusprigen Schokoladenkeks. Oder sie vertilgt ein respektables Stück vom Streuselkuchen aus der klinikeigenen Cafeteria, die Torten in Hausmacherqualität zu bieten hat, aber für Insassen der „beschützten“ (geschlossenen) Abteilung unzugänglich ist, solange kein Besucher ihren Rollstuhl dorthin schiebt.
Zimmerservice gehört leider nicht zu den zubuchbaren „Wahlleistungen“ der Klinik, so dass der leckere Kuchen nicht einmal für viel Geld und gute Worte zu den Verwirrten findet. Schleckereien sind das Privileg der… (nein, nicht der Privatpatienten, denn eine solche ist unsere alte Dame auch) …der weniger schlimm Erkrankten und der Besucher.
Strafe muss sein. Oder?
Patient einer geschlossenen Station ist man nicht zum Vergnügen. Man ist interniert, weil man nicht kapiert, was man hier soll, und deshalb weg will: nur weg von hier, zurück in ein Zuhause aus besseren Tagen, das man alleine nicht finden würde. Man kommt als Unfallopfer und wird behandelt wie ein Häftling. Die Schutzhaft soll den Patienten vor sich selbst schützen und ist doch zugleich auch eine Strafe für den alltäglichen Leichtsinn, der manchmal für alte Leute Lebensqualität bedeutet. So gibt es in jedem Seniorenheim gut gemeinte Regeln zur Sturzprävention, und doch stürzen jeden Tag etliche Senioren, denn konsequent von allen Stolperfallen befreite Wohnungen sind ihnen zu steril: Ohne rutschige Teppiche auf dem Parkett ist es ihnen nicht wohnlich genug.
Die Nase isst mit…
Es kann vorkommen, dass die alte Dame die feine Konditorware verschmäht – aber nur, weil ihre feine Nase den Sturz völlig unbeschadet überstanden hat. Wo es stinkt, riecht sie kein Vanillearoma, keine Schokonote, keinen Kirsch- und Kaffeeduft. Und solange ihr angeschlagener Kopf nicht nur die Kontrolle über ihr Sprachzentrum wiedergewinnen muss, sondern auch die über ihren Schließmuskel, scheint sie der Gestank manchmal regelrecht zu verfolgen. Die Schwestern haben sie in eine Inkontinenzwindel gepackt, aber die quillt irgendwann über, ohne dass die Patientin es merkt. Was der Frau stinkt, ist sie selbst. Sie registriert nicht, dass sie die Hosen voll hat, legt die Hände in den Schoss, und schon ist es passiert. Als sie die Kuchengabel zum Mund führen will, ist es in ihrer Wahrnehmung der Kuchen, der – pardon! – nach nassen, vollgeschissenen Pampers stinkt.
Als Gesunde können wir in so unangenehmen Situationen unsere Sinne in gewissem Umfang steuern und uns auf den Genuss-Reiz halbwegs konzentrieren und fokussieren. Werden wir aber in den archaischen Status eines kognitiv minderbemittelten Instinktwesens zurückgeworfen, funktionieren unsere Sinne primär als Alarmanlagen. Nase, Auge, Ohr warnen uns vor Gefahr wie einst in der Savanne. Strenger Geruch steht für Essen, das krank macht. Die Patientin isst nicht? Ja, warum wohl!
Der Sohnemann macht die Probe aufs Exempel, holt sich Papierservietten, tränkt diese mit Isopropanol-Lösung aus einem der in Klinikfluren allgegenwärtigen Sprühspender und wischt seiner Mutti liebevoll die Finger ab, so wie sie ihm vor 50 Jahren beim Wienerwald mit dem Zitronentuch das Hendlfett von den Händchen gewischt hat. Und siehe da: Der Kuchen schmeckt ihr eben doch.
…und das Auge sowieso
Zurück auf der Station, es ist fast 17 Uhr, wartet oben im Multifunktionsraum schon das Abendbrottablett, eine Sinfonie von hellen Erdtönen. Wie viel zu viele andere Häuser bedient sich auch diese Klinik eines Caterers, der bei den Brotzeiten gerne die Farbskala zwischen cremefarben über beige bis graubraun ausreizt. (Auch bei den warmgehaltenen (Vor-)Mittagsmahlzeiten, die zu einer Tageszeit gekocht wurden, zu der normale Menschen frühstücken, versteht der Lieferant den Spruch „das Auge isst mit“ offenbar als Warnung, die ihn bemüßigt, genau diese Mitesserei zu verhindern. Jedenfalls bemüht er sich mit solcher Verve um Blässe, dass dem Auge der Appetit vergeht und das Wasser keine Lust hat, im Mund zusammenzulaufen.)
Die Mahlzeit vor Augen und ihren beißenden Eigenmief in der Nase, stemmt die Patientin ihre Pantinen so energisch ins Linoleum, dass der Sohn ihren Rolli nicht gewaltfrei an den Tisch bugsieren kann. Die Schwestern jedoch haben ihre inneren Nasenklammern aktiviert und arbeiten erst einmal den Programmpunkt „Verköstigung“ ab; die Windel muss warten. Später, nach dem Duschen und Bettfertigmachen, darf der Sohn noch einmal ins Mutters Zimmer, und siehe da, sie isst ohne Murren eine Scheibe Weißbrot. Deren Aufstrich, feine Leberwurst, hat durchs Antrocknen ein wenig Farbe bekommen und verströmt, wenn auch vom Hersteller ungewollt, mittlerweile ein deutlich wahrnehmbares Aroma.
Die Patientin isst nicht? Nein, Herr Doktor. Sie isst nicht, was und wann sie soll. Und solange sie deutlich dicker bleibt als Magersüchtige, die frei herumlaufen dürfen, wird sie keines Hungertodes sterben. Sie isst, wenn sich eine zeitliche Koinzidenz zwischen Appetit und appetitlichen Speisen ergibt, oder wenn’s der Hunger reintreibt. Wer wenig Hunger hat, dem treibt es halt auch nicht viel rein. Dem muss man Lust aufs Essen machen, indem man ihm etwas Frisches, lecker Duftendes in Reichweite stellt, etwa Obst, und es ihm überlässt, wann er es isst. Wer langweiliges Graubrot serviert und rasch wieder abräumt, weil keine Essenzeit mehr ist, motiviert niemanden zum Essen, sondern schafft sich gravierendere Probleme. Widerspenstigen Patienten, die problemlos kauen und schlucken können, eine Magensonde zu legen, wenn sie die Aufnahme unappetitlicher Nahrung verweigern, ist keine Lösung – und zum Glück bedürfen solche ethisch grenzwertigen Zwangsmaßnahmen der Zustimmung eines Amtsrichters. Dass die Personaldecke nicht ausreicht, um alle essfähigen Problempatienten auf konventionelle Weise mit menschenwürdiger Nahrung zu versorgen, kann dabei kein Argument sein. Die Patienten sind die Kunden, mit denen die Kliniken ihr Geld verdienen. Wenn sich der Geschäftsprozess nicht an ihrem Wohl ausrichtet, ist das ganz platt und simpel Missmanagement.
Fassen wir den Zusammenhang von Appetit, Hunger und Nahrungsaufnahme also für die Manager dieser und anderer Kliniken noch mal in ein paar Powerpoint-Thesen zusammen:










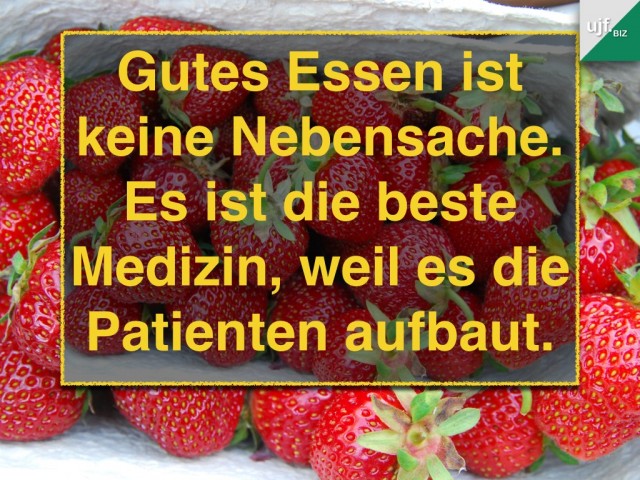

Die Verwendung dieser Charts ist frei gemäß CC BY-NC-SA.
Sie sind der oder die 1169. Leser/in dieses Beitrags.


